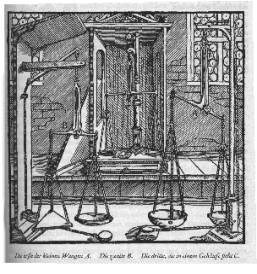Seite 4 Handwerk
Der Probirer, ein mittelalterlicher Beruf
Im Frühneuhochdeutschen bedeutet „probiren“ so viel wie
„analysieren“. Ein Probirer war also ein Mann, der Proben untersuchte, z. B.
Erze auf ihren Metallgehalt hin. Besonders wichtig war diese Tätigkeit
natürlich im Zusammenhang mit dem Bergbau, wenn es um die Abbauwürdigkeit von
Erzen ging, besonders bei Silber- oder Goldvorkommen. Die angewandten
analytischen Methoden waren dabei die gleichen, wie sie auch im grossen
Produktionsmassstab durchgeführt wurden, nur eben im kleinen Labormassstab.
|
|
Ein Probirer vor seinem Probirofen nach Agricola 1556 |
Es scheint regelrechte Laboratorien gegeben zu haben, die
solche Arbeiten durchführten; z. B. ist eines aus Basel bekannt (P. Kamber, P.
Kurzmann mit einem Beitrag von Y. Gerber, Der Gelbschmied und Alchemist(?) vom
Ringelhof, in: Jahresbericht 1998 der Archäologischen Bodenforschung des
Kantons Basel-Stadt (1999) 151-99) , ein zweites aus Freiburg/Br. (Th. Rehren,
Die Tiegel und Schmelzschalen aus der Freiburger Innenstadt, in: L. Galioto, F.
Löbbecke, S. Kaltwasser, Das Haus „Zum Roten Basler Stab“ (Salzstr. 20) in
Freiburg im Breisgau (2002) 531-38).
Die Probirer verfügten nach Agricola bereits über gute
Waagen.
|
Auf dem Bild sind drei ungedämpfte Zweischalenwaagen zu
sehen, zwei frei hängende und hinten eine zum Schutz gegen Zugluft in einem
Gehäuse untergebrachte. An der linken Waage besonders gut zu erkennen: die Waage
kann mit Hilfe einer Schnur und eines Hebels hochgezogen und niedergelassen
werden, der Stein am Ende der Schnur fixiert die jeweilige Lage. Diese
Vorrichtung ermöglicht das Abbremsen der Schwingungen des Waagebalkens und
somit eine rasche Durchführung der Wägungen. |
|
Es ist also nicht richtig, wenn die Einführung des Wägens in
die Chemie dem Chemiker Antoine L. Lavoisier (1743-1794) zugeschrieben wird.
Agricola beschreibt bereits 1555 (lateinische Ausgabe!) hoch entwickelte
Waagen, die bei analytischen Arbeiten benutzt wurden.
Die archäologischen Funde aus Basel und Freiburg lassen
erkennen, dass die Probirer neben dieser Tätigkeit auch eine
metallverarbeitende ausübten.
In den Wohnhäusern von Bergleuten in ausgegrabenen
Bergbaustädten (z. B. auf dem Treppenhauer bei Sachsenburg) wurden kleine Öfen und Keramikfragmente
nachgewiesen, die als Probiröfen und dazugehörige Keramik-Gefässe gedeutet
werden. Hier scheinen die Bergleute als Probirer tätig geworden zu sein,
vielleicht untersuchten sie Proben aus ihrer Weilarbeit (aus sozialer Not
ausgeübte Nebentätigkeit in einem eigenen kleinen Bergwerk).
Das Rauchgerben
Beim Stichwort “Gerberei im Mittelalter“ denkt man
üblicherweise an drei Gerbverfahren: das Rotgerben, das Weissgerben und das
Fettgerben (Sämischgerben). Eine vierte Art der Gerbung, die Rauchgerbung, wird
selten behandelt ( so aber im Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, XI,
Stichwort „Gerberei“ §§ 2-4, bearbeitet von M. Wintergerst).
Gerbereien können relativ häufig auf archäologischem Wege
nachgewiesen werden: die Gerbergruben sind ein charakteristischer Befund.
Leider lässt ihre analytische Untersuchung generell zu wünschen übrig.
M. Wintergerst (Produktionsanlagen mittelalterlicher
Handwerker in Regensburg, in: M. Angerer, H. Wanderwitz (Hrsg.), Regensburg im
Mittelalter (1995) 259-66) publizierte andersartige Befunde, von denen hier
einer beispielhaft behandelt werden soll.
|
|
Regensburg, Am
Singrün 2, Anlage Nr. 3. Die gefundene Keramik erlaubt eine Datierung in das
14./15. Jh. |
Es handelt sich um ein horizontales Ofen-Tonnengewölbe, das
mit einem offenen Ende in einen grossen, sauber verputzen Raum (Innenmasse 3,2
x 4,9 m) hineinragt. Das andere Ende mündet mit einer kleinen Öffnung in einen
Vorraum, der nach oben hin einen Rauchabzug ermöglichte. Der Vorraum war
begehbar. Die Anlage wurde im Niedrigtemperaturbereich betrieben.
Der Kontext lässt an eine Anlage zur Lederherstellung
denken. Wintergerst vermutet in ihr eine Wärmekammer (Schwitzkammer), die von
dem Vorraum aus beheizt wurde. Zitat: „Wie die angeglühten und verziegelten
Teile zeigen, ging die Zugführung in Richtung Vorraum“.
Der Autor der vorliegenden Seite wundert sich hierüber. Dies
würde nämlich bedeuten, dass der „Heizer“ im Rauch steht – eine unübliche
Anordnung. Logischer wäre eine Zugrichtung vom Vorraum aus in den grossen Raum,
in den dadurch der Rauch gelangen würde – eine Rauchgerbung wäre möglich. Der
archäologische Befund scheint jedoch gegen diese Interpretation zu sprechen.
Es bleibt zu hoffen, dass diese Frage anhand
zukünftiger Grabungsergebnisse geklärt
werden kann.
Der Autor dankt M. Wintergerst für den Hinweis auf seinen
Artikel im Reallexikon und für die Diskussion über diesen Komplex.
Teuchel und ihre Herstellung
Teuchel oder Deichel sind Wasserleitungsrohre, auch
Pumpenrohre aus Holz. Sie wurden durch Ausbohren von Baumstämmen mit Hilfe der
Teuchelbohrer hergestellt. Bei Agricola findet sich eine Abbildung hierzu.
|
|
Das Herstellen eines Teuchels nach Agricola |
Ein Teuchelbohrer und ein Teuchel unbekannter Datierung
hängen im Torgewölbe der Burg Zavelstein bei Bad Teinach/Württemberg.
|
|
Teuchelbohrer und Teuchel aus Zavelstein. Laenge des Teuchels: 216 cm Innendurchmesser des Teuchels: 6,5 cm Der Teuchel trägt innen an einem Ende ein kurzes
dünnwandiges Eisenrohr als Verbindungsstück zum nächsten Teuchel. |
Teuchel wurden auf Vorrat hergestellt und mussten unter
Wasser aufbewahrt werden. Hiervon zeugen noch heute erkennbare Teuchelgruben
oder –weiher (z. B. eine Teuchelgrube bei Herrenberg Kr. Böblingen/Württemberg,
die Deichelweiher im SO Freiburgs i. Br.).
|
|
Das „Rote Meer“ bei Herrenberg Kr. Böblingen, eine
Teuchelgrube. Der Name rührt von der roten Färbung des früher darin stehenden
Wassers, die der rote Erdboden ihm erteilte. Länge der keilförmigen Grube ca. 28 m, Breite ca. 2 bzw. 5
m, Tiefe ca. 1 m. Die Schmalseiten sind gerundet. |